


Liebe Gläubige, liebe Freunde und Wohltäter!
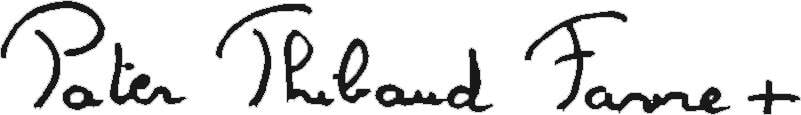
Mit grosser Freude dürfen wir dieses Jahr den 1700. Jahrestag des ersten Konzils von Nicäa feiern, das im Sommer 325 stattfand. Es lädt uns ein, für dieses grundlegende Ereignis zu danken, das Leben und Glauben der noch jungen Kirche tief geprägt hat.
Das Konzil von Nicäa befasste sich mit mehreren disziplinarischen Fragen – wie dem Platz der Patriarchen im Orient oder der Festlegung des Osterdatums. Sein wesentlicher Beitrag war aber doktrinaler Natur. Es setzte der Häresie des Arius ein Ende und verkündete feierlich die zentrale Wahrheit unseres Glaubens, die wir jeden Sonntag im Credo singen: Der Sohn ist „eines Wesens mit dem Vater“.
Indem es die Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus mit leuchtender Klarheit bekräftigte, schützte Nicäa nicht nur den Glauben, sondern festigte auch die Grundlagen der Theologie der noch jungen Kirche. Dieser erste grosse Akt der Einheit in der Lehre bleibt ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Christentums. Da die Arianer die Bedeutung der Heiligen Schrift verdrehten, um sie ihrer Lehre anzupassen, wollte das Konzil einen eindeutigen Begriff verwenden, den die Ketzer jedoch vehement ablehnten: wesensgleich (homoousios auf Griechisch). Dieses Wort bekräftigt, dass der Sohn wesensgleich ist wie der Vater. Zwar hatte der Begriff „Wesen“ noch nicht die spätere philosophische Präzision, aber die Absicht der Konzilsväter ist ganz klar: Der Sohn besitzt dasselbe Wesen wie der Vater. So wie ein Mensch einen Menschen zeugt, so ist das, was von Gott gezeugt wird, Gott. Der Sohn ist also im eigentlichen Sinne Gott, dem Vater gleich, und teilt mit ihm die Fülle der Gottheit. Der Vater und der Sohn sind durch ihre Personen voneinander getrennt, aber eins in der göttlichen Substanz.
Vom Konzil von Nicäa sind uns nur unvollständige Akten erhalten geblieben. Was wir darüber wissen, stammt aus zeitgenössischen Zeugnissen – insbesondere denen von Eusebius von Caesarea und Athanasius – sowie aus Schriften, die über die Verurteilung des Arius berichten. Vor allem besitzen wir das Glaubensbekenntnis, das wir heute als das Nicäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis bezeichnen und in dem der Kern der in Nicäa definierten Lehre zum Ausdruck kommt. Dieses Bekenntnis, das 325 verfasst und 381 in Konstantinopel ergänzt wurde, wird jeden Sonntag und an hohen Feiertagen als feierliche Verkündigung des katholischen Glaubens gesungen: „Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen“. Diese Worte von bewundernswerter Präzision fassen den Kern des christlichen Glaubens zusammen: Jesus Christus ist wahrhaftig Gott, dem Vater von Natur aus gleich und nicht nur in seiner Würde. Mit dieser Aussage hat die Kirche für immer die Tür zu den Zweideutigkeiten des Arius geschlossen und den Glauben an die Göttlichkeit des Erlösers für Jahrhunderte gefestigt.
Unter den grossen Konzilien der Kirchengeschichte strahlt das Konzil von Nicäa in besonderem Glanz. Am auffälligsten ist jedoch die Gestalt des heiligen Athanasius, dieses jungen Bischofs von Alexandrien, der fast allein gegen viele wagte, den katholischen Glauben in seiner ganzen Reinheit zu verteidigen, während Kompromisse und politischer Druck zu triumphieren schienen. Er suchte weder den leichten Frieden noch die Zustimmung der Mächtigen, sondern die Wahrheit Christi. Als er überstimmt und dann von der Zivilmacht verurteilt wurde, zog er das Exil dem Verrat am Glauben vor. Sein Beispiel erinnert uns daran, dass die Wahrheit nicht von der Zahl derer abhängt, die sie bekennen, sondern von dem, der ihre Quelle ist.
Auch heute noch ist der Mut des Athanasius ein Aufruf. Den Glauben zu verteidigen ist nie bequem, aber immer notwendig. In einer Welt, in der die Wahrheit verhandelbar ist und Treue stört, lehrt uns sein Beispiel, dass die Wahrheit sich nicht dem Wind der Mode beugt: Sie wird betrachtet, gelebt und verteidigt – manchmal um jeden Preis.
Das Konzil von Nizäa bleibt in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für die Kirche. Als eines der ersten, das die grossen Fragen der Lehre so klar entschied, veranschaulicht es, was immer die Quelle ihrer Fruchtbarkeit war: die klare Darlegung der Wahrheit und die ausdrückliche Verurteilung des Irrtums. So hat die Kirche immer gehandelt: zuerst das Licht der Lehre, dann der Elan des apostolischen und pastoralen Eifers. Die Sorge um die Seelen steht niemals im Gegensatz zur Klarheit des Glaubens, sondern ergibt sich daraus. Das Licht geht der Wärme voraus, so wie die Wahrheit der Nächstenliebe vorausgeht. Umgekehrt zeigt die jüngste Geschichte, wie sehr ein Konzil, das sich ausschliesslich als pastoral versteht, diese Klarheit zu schwächen droht. Papst Paul VI. schrieb in seinem Brief vom 29. Juni 1975 an Msgr. Marcel Lefebvre: „Wie könnte sich heute jemand mit dem heiligen Athanasius vergleichen und es wagen, ein Konzil wie das Zweite Vatikanische Konzil zu bekämpfen, das nicht weniger Autorität hat und in mancher Hinsicht sogar noch wichtiger ist als das Konzil von Nicäa?“ [1]
Eine erstaunliche Aussage! Denn das Zweite Vatikanische Konzil wollte nach eigenem Bekunden kein Dogma definieren, sondern nur zu den Menschen seiner Zeit sprechen. Diese Entscheidung offenbart, was man als seinen eigentlichen Fehler bezeichnen könnte: lehren zu wollen, ohne zu verurteilen, zu sprechen, ohne zu entscheiden, zu erleuchten, ohne zu urteilen. Die Kirche wuchs jedoch nie im Durcheinander, sondern in der Klarheit. Es ist das Licht der Wahrheit, nicht die Zweideutigkeit der Sprache, die die Seelen anzieht und bekehrt. Die Stärke von Nicäa und die des heiligen Athanasius bestand darin, dass sie die Wahrheit der Popularität, die Treue dem Frieden der Kompromisse vorgezogen haben.
Dieses Licht, das das Konzil von Nicäa der Kirche geschenkt hat, liebe Gläubige der Schweiz, müssen auch wir in uns leuchten lassen. Die Klarheit der Lehre ist nicht den Konzilien und Theologen vorbehalten: Sie muss in jeder christlichen Seele leben. Wir haben die Pflicht, uns weiterzubilden, zu vertiefen, zu studieren und die Schätze unseres Glaubens besser kennenzulernen. Diese intellektuelle Bildung muss mit einer ebenso grossen Entschlossenheit in der Abwehr von Irrtümern einhergehen. Das eine geht nicht ohne das andere: indem man die Wahrheit liebt, lernt man das abzulehnen, was sie verzerrt.
Mit dieser Klarheit des Glaubens muss sich der apostolische Eifer verbinden, der Wunsch, die Seelen zu bekehren und sie zu Gott zu führen. Wahrheit ohne Liebe verdorrt, aber Liebe ohne Wahrheit verirrt sich. Zusammen bilden sie das übernatürliche Gleichgewicht des gläubigen Christen.
In diesem Monat November wollen wir unsere Gebete den Seelen im Fegefeuer zuwenden, besonders jenen, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Mögen sie uns dazu verhelfen, in unserer Zeit der Verwirrung den gleichen Eifer, die Wahrheit zu verteidigen, die gleiche Klarheit im Glauben und die gleiche Liebe zu Gott zu bewahren.
[1] Vgl. Katholische Dokumentation, 58, 1976, S. 34.



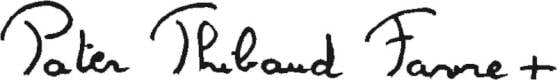
Mit grosser Freude dürfen wir dieses Jahr den 1700. Jahrestag des ersten Konzils von Nicäa feiern, das im Sommer 325 stattfand. Es lädt uns ein, für dieses grundlegende Ereignis zu danken, das Leben und Glauben der noch jungen Kirche tief geprägt hat.
Das Konzil von Nicäa befasste sich mit mehreren disziplinarischen Fragen – wie dem Platz der Patriarchen im Orient oder der Festlegung des Osterdatums. Sein wesentlicher Beitrag war aber doktrinaler Natur. Es setzte der Häresie des Arius ein Ende und verkündete feierlich die zentrale Wahrheit unseres Glaubens, die wir jeden Sonntag im Credo singen: Der Sohn ist „eines Wesens mit dem Vater“.
Indem es die Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus mit leuchtender Klarheit bekräftigte, schützte Nicäa nicht nur den Glauben, sondern festigte auch die Grundlagen der Theologie der noch jungen Kirche. Dieser erste grosse Akt der Einheit in der Lehre bleibt ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Christentums. Da die Arianer die Bedeutung der Heiligen Schrift verdrehten, um sie ihrer Lehre anzupassen, wollte das Konzil einen eindeutigen Begriff verwenden, den die Ketzer jedoch vehement ablehnten: wesensgleich (homoousios auf Griechisch). Dieses Wort bekräftigt, dass der Sohn wesensgleich ist wie der Vater. Zwar hatte der Begriff „Wesen“ noch nicht die spätere philosophische Präzision, aber die Absicht der Konzilsväter ist ganz klar: Der Sohn besitzt dasselbe Wesen wie der Vater. So wie ein Mensch einen Menschen zeugt, so ist das, was von Gott gezeugt wird, Gott. Der Sohn ist also im eigentlichen Sinne Gott, dem Vater gleich, und teilt mit ihm die Fülle der Gottheit. Der Vater und der Sohn sind durch ihre Personen voneinander getrennt, aber eins in der göttlichen Substanz.
Vom Konzil von Nicäa sind uns nur unvollständige Akten erhalten geblieben. Was wir darüber wissen, stammt aus zeitgenössischen Zeugnissen – insbesondere denen von Eusebius von Caesarea und Athanasius – sowie aus Schriften, die über die Verurteilung des Arius berichten. Vor allem besitzen wir das Glaubensbekenntnis, das wir heute als das Nicäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis bezeichnen und in dem der Kern der in Nicäa definierten Lehre zum Ausdruck kommt. Dieses Bekenntnis, das 325 verfasst und 381 in Konstantinopel ergänzt wurde, wird jeden Sonntag und an hohen Feiertagen als feierliche Verkündigung des katholischen Glaubens gesungen: „Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen“. Diese Worte von bewundernswerter Präzision fassen den Kern des christlichen Glaubens zusammen: Jesus Christus ist wahrhaftig Gott, dem Vater von Natur aus gleich und nicht nur in seiner Würde. Mit dieser Aussage hat die Kirche für immer die Tür zu den Zweideutigkeiten des Arius geschlossen und den Glauben an die Göttlichkeit des Erlösers für Jahrhunderte gefestigt.
Unter den grossen Konzilien der Kirchengeschichte strahlt das Konzil von Nicäa in besonderem Glanz. Am auffälligsten ist jedoch die Gestalt des heiligen Athanasius, dieses jungen Bischofs von Alexandrien, der fast allein gegen viele wagte, den katholischen Glauben in seiner ganzen Reinheit zu verteidigen, während Kompromisse und politischer Druck zu triumphieren schienen. Er suchte weder den leichten Frieden noch die Zustimmung der Mächtigen, sondern die Wahrheit Christi. Als er überstimmt und dann von der Zivilmacht verurteilt wurde, zog er das Exil dem Verrat am Glauben vor. Sein Beispiel erinnert uns daran, dass die Wahrheit nicht von der Zahl derer abhängt, die sie bekennen, sondern von dem, der ihre Quelle ist.
Auch heute noch ist der Mut des Athanasius ein Aufruf. Den Glauben zu verteidigen ist nie bequem, aber immer notwendig. In einer Welt, in der die Wahrheit verhandelbar ist und Treue stört, lehrt uns sein Beispiel, dass die Wahrheit sich nicht dem Wind der Mode beugt: Sie wird betrachtet, gelebt und verteidigt – manchmal um jeden Preis.
Das Konzil von Nizäa bleibt in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für die Kirche. Als eines der ersten, das die grossen Fragen der Lehre so klar entschied, veranschaulicht es, was immer die Quelle ihrer Fruchtbarkeit war: die klare Darlegung der Wahrheit und die ausdrückliche Verurteilung des Irrtums. So hat die Kirche immer gehandelt: zuerst das Licht der Lehre, dann der Elan des apostolischen und pastoralen Eifers. Die Sorge um die Seelen steht niemals im Gegensatz zur Klarheit des Glaubens, sondern ergibt sich daraus. Das Licht geht der Wärme voraus, so wie die Wahrheit der Nächstenliebe vorausgeht. Umgekehrt zeigt die jüngste Geschichte, wie sehr ein Konzil, das sich ausschliesslich als pastoral versteht, diese Klarheit zu schwächen droht. Papst Paul VI. schrieb in seinem Brief vom 29. Juni 1975 an Msgr. Marcel Lefebvre: „Wie könnte sich heute jemand mit dem heiligen Athanasius vergleichen und es wagen, ein Konzil wie das Zweite Vatikanische Konzil zu bekämpfen, das nicht weniger Autorität hat und in mancher Hinsicht sogar noch wichtiger ist als das Konzil von Nicäa?“ [1]
Eine erstaunliche Aussage! Denn das Zweite Vatikanische Konzil wollte nach eigenem Bekunden kein Dogma definieren, sondern nur zu den Menschen seiner Zeit sprechen. Diese Entscheidung offenbart, was man als seinen eigentlichen Fehler bezeichnen könnte: lehren zu wollen, ohne zu verurteilen, zu sprechen, ohne zu entscheiden, zu erleuchten, ohne zu urteilen. Die Kirche wuchs jedoch nie im Durcheinander, sondern in der Klarheit. Es ist das Licht der Wahrheit, nicht die Zweideutigkeit der Sprache, die die Seelen anzieht und bekehrt. Die Stärke von Nicäa und die des heiligen Athanasius bestand darin, dass sie die Wahrheit der Popularität, die Treue dem Frieden der Kompromisse vorgezogen haben.
Dieses Licht, das das Konzil von Nicäa der Kirche geschenkt hat, liebe Gläubige der Schweiz, müssen auch wir in uns leuchten lassen. Die Klarheit der Lehre ist nicht den Konzilien und Theologen vorbehalten: Sie muss in jeder christlichen Seele leben. Wir haben die Pflicht, uns weiterzubilden, zu vertiefen, zu studieren und die Schätze unseres Glaubens besser kennenzulernen. Diese intellektuelle Bildung muss mit einer ebenso grossen Entschlossenheit in der Abwehr von Irrtümern einhergehen. Das eine geht nicht ohne das andere: indem man die Wahrheit liebt, lernt man das abzulehnen, was sie verzerrt.
Mit dieser Klarheit des Glaubens muss sich der apostolische Eifer verbinden, der Wunsch, die Seelen zu bekehren und sie zu Gott zu führen. Wahrheit ohne Liebe verdorrt, aber Liebe ohne Wahrheit verirrt sich. Zusammen bilden sie das übernatürliche Gleichgewicht des gläubigen Christen.
In diesem Monat November wollen wir unsere Gebete den Seelen im Fegefeuer zuwenden, besonders jenen, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Mögen sie uns dazu verhelfen, in unserer Zeit der Verwirrung den gleichen Eifer, die Wahrheit zu verteidigen, die gleiche Klarheit im Glauben und die gleiche Liebe zu Gott zu bewahren.
[1] Vgl. Katholische Dokumentation, 58, 1976, S. 34.